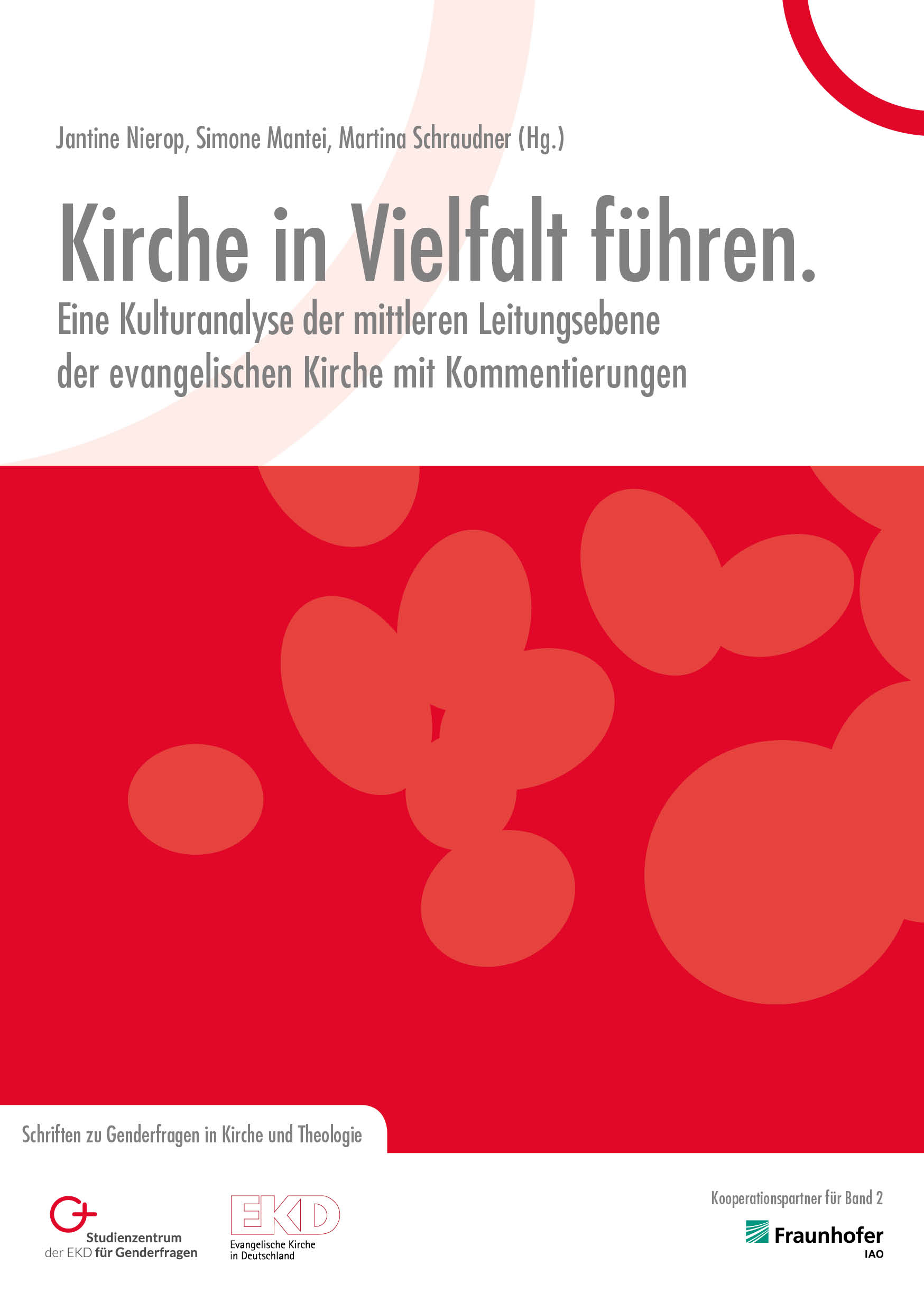Studienzentrum in der Presse
Passt Gott zu Gender?
Die größten Verfechterinnen und die erbittertsten Gegnerinnen der sexuellen Vielfalt treffen aufeinander - in der evangelischen Kirche. Und alle sind von tiefer Frömmigkeit geprägt
Matthias aus Stuttgart hat sich zur Konfirmation geoutet. Als die ganze Verwandtschaft da war und eine Reihe von Freunden, seine, die der beiden Brüder und der Eltern. Er hat sich seinen neuen Namen selbst ausgesucht. Gemeinsam mit der Familie hat er ein anderes Leben geplant.
Marina, seine Mutter, hat es lange gespürt und als Erste gewusst. Sie versucht sich jetzt damit abzufinden, dass sie drei Söhne hat. Alle mussten sich an den neuen Namen gewöhnen. Bis zur Konfirmation hieß Matthias Sina. Uns, die wir ihn kannten, war aufgefallen, dass Sina schon ein paar Jahre Jungenkleidung trug. Und erzählte, dass sie mit den Jungen der Klasse gut auskommt, nicht wie ein Mädchen, sondern weil sie den Sport der Jungen gerne mitmachte und so dachte wie sie. Marina, ihre Mutter, ärgerte sich noch, wenn sie erzählte, dass manche in der Klasse sagten, Sina sei ja gar kein richtiges Mädchen. Sie ist auch ein bisschen gebaut wie ein Junge, haben wir gedacht, aber nie gesagt. Jetzt ist Sina Matthias. Alle wissen es. Der Pfarrer hat ihn unterstützt. Das hilft. Manche aus dem Freundeskreis haben ihm und seiner Mutter geschrieben. Das tat der Familie gut. Jetzt geht Matthias zum Psychotherapeuten. Ob er operiert wird, das ist ein Gedanke, aber er ist ja erst 16. Auch wenn er sich lange schon als Junge gefühlt hat, muss er sich in das neue Leben hineinfinden. Und die Familie auch. Wir, die Freunde, müssen sehen, dass wir mitkommen. Aber vor allem wünschen wir ihm, dass er seinen Weg findet, dass er auf Menschen stößt, die ihn verstehen und lieb gewinnen, die ihn fördern und denen er viel bedeutet.
Matthias braucht aufgeschlossene Menschen. Wissenschaftler sagen: Er braucht Gendersensibilität. Darum streiten sich Protestanten, Evangelikale und Liberale, Rechte und Linke, manchmal bis aufs Blut - ein Moralriss in der evangelischen Kirche.
Was ist Gender? Es ist das, was Claudia Janssens Berufsleben ausmacht. Für sie ist Gott nah bei Gender. Gender ist für sie ein Platzhalter für etwas, was man sprachlich nicht eingrenzen kann. So wie Gott. Auch den kann man sprachlich nicht eingrenzen. Gender, das ist die Aufmerksamkeit dafür, dass manche Menschen wie Philipp unglücklich sind, wenn sie in ihrem Geschlecht bleiben. Andere sind unglücklich, wenn sie eindeutig Mann oder Frau sein sollen. Oder wenn ihr Denken und Empfinden beim einen Geschlecht verankert sein und sich zum anderen hingezogen fühlen soll, weil ein Mädchen irgendwann einen Freund und ein Junge eine Freundin hat, eigentlich. Bei manchen ist das nicht so eindeutig, nicht das, was sie sind, und nicht das, wozu sie sich hingezogen fühlen. Auch bei Gott ist vieles nicht eindeutig. Er ist nah und fern, freundlich und rätselhaft. Die Bibel beschreibt ihn als den Herrn der Heerscharen, aber auch als einen, der trösten kann wie eine Mutter. Bei Gott ist das richtig und wunderbar, bei Menschen, die nicht eindeutig sind, spiegelt sich die Vielfalt der Schöpfung. Sagt Claudia Janssen. »Ich gebrauche lieber das Wort >geschlechterbewusst< als Gender, wenn ich es erklären muss«, sagt sie.
In den Augen ihrer Gegnerinnen und Gegner ist Claudia Janssen deshalb eine Ideologin. Das kann nicht glauben, wer mit ihr spricht. Eine sanfte, freundlich gefärbte Telefonstimme ohne Eile im Ton. Claudia Janssen hört sich geduldig jedes Argument an. Nur andeutungsweise zeigt sie die Standhaftigkeit, vielleicht auch die Hartnäckigkeit, die Menschen entwickeln, die eine Botschaft haben und auf Widerstand stoßen.
Claudia Janssen ist außerplanmäßige Professorin für Neues Testament an der Universität Marburg und wird zu den führenden feministischen Theologinnen gezählt. Sie hat den Marga-Bührig-Preis bekommen und den Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preis, sie sitzt in der Jury des Hanna-Jursch-Preises. Den verleiht die evangelische Kirche seit 13 Jahren für Forschungsarbeiten aus der Sicht von Frauen. Claudia Janssen arbeitet im Studienzentrum für Genderfragen der evangelischen Kirche in Hannover. Und sie gehört zu den »Exegetinnen und Exegeten des Evangelischen Kirchentages«.
Da ist das Thema lange schon zu Hause. Schon 200 Menschen unterstützen auf den Internetseiten des Kirchentages einen Resolutionsentwurf unter dem Thema: »Wir wollen nicht erduldet werden!« Lesbische Frauen, heißt es da, »schwule Männer, bisexuell lebende Frauen und Männer, Transgender und Intersexuelle, queer lebende Menschen wissen es als Christinnen und Christen ebenso wie heterosexuell lebende Menschen: Sie sind Gottes Ebenbilder.« Die Resolution klagt das Nichthandeln in Kirchenleitungen an und die Diskriminierung durch Mitchristen.
»Wir wollen nicht erduldet werden« lautet auch das Motto einer Veranstaltung des »Zentrums Regenbogen« in der Fellbacher Schwabenlandhalle östlich vor den Toren der Stadt. Sie behandelt den Streit um den Bildungsplan in Baden-Württemberg, ein Renommierprojekt der Regierung, das sexuelle Vielfalt in den Lehrplänen verankern will. Für Genderbewusste ist die irische Volksabstimmung mit der Mehrheit für gleichgeschlechtliche Ehen ein willkommener Etappensieg. Es zählt auch nur als Zwischenschritt, dass Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, das irische Abstimmungsergebnis begrüßt, ganz anders als katholische Kirchenführer.
Ansonsten ist die evangelische Kirche mit 33 Prozent Pfarrerinnen gendermäßig gut aufgestellt, während die katholische nicht über ihr Nein zur Priesterin hinwegkommt. Aber fast die Hälfte der Pfarrerinnen arbeitet in Teilzeit. Zum Internationalen Frauentag hat das Genderzentrum einen Gleichstellungsatlas vorgelegt. Er zeigt, dass Frauen in den ehrenamtlichen Leitungen der Gemeinden überrepräsentiert sind. Bei den Hauptamtlichen wird es dünner. Gerade erforscht das Zentrum die Anteile auf der mittleren Führungsebene. Der Frauenanteil wird mitunter kritisiert. Den Münchner Theologen Friedrich Wilhelm Graf stört der Einzug von »Mutti-typen« in die Kirche. Für ihn spiegelt sich darin auch ein Verlust an Bildung, die das Pfarrhaus geprägt hat. Aber es muss weitergehen bei der Anerkennung sexueller Vielfalt. Auch wenn es immer weniger Menschen betrifft, je vielfältiger es wird. »Es gibt keine Zahlen«, sagt Claudia Janssen. Die Zahl der Intersexuellen, die Chromosomen oder sichtbare Merkmale beider Geschlechter tragen, wird manchmal auf ein halbes Prozent der Bevölkerung geschätzt. Alles Weitere ist unklar. Auch, wie viele Gruppen es zwischen Transfrauen, Transmännern, Interqueeren und Transgendern gibt. Und ist es wichtig, Conchita Wurst eindeutig zuordnen zu können, eine Frau mit einem bärtigen Gesicht wie ein Jesus aus der Malschule der Nazarener?
Janssen will sich auf Zahlen gar nicht erst einlassen: »Ein Kind, das fürchterliche Behandlungen über sich ergehen lassen muss, um die Norm der Zwei-geschlechtlichkeit zu erfüllen, ist eins zu viel.« Dafür streitet sie, dafür streiten Menschen auf dem Kirchentag schon seit Jahren.
Genderbewegte scheinen fromm zu sein. So wie ihre größten Gegner. Die kommen im Protestantismus vor allem aus den Kreisen der Evangelikalen. Die Evangelikalen veranstalten mitten im Kirchentag ihren »Christustag« in eigener Regie. Dort kommt das Wort »Gender« nicht vor. Denn es ist unter vielen Evangelikalen ein Unwort. Deshalb findet es sich dort oft kombiniert mit »Wahn« oder »Ideologie«. Pfarrer Steffen Kern, einer der Hauptverantwortlichen des Christustages und der Organisationen, die dahinter stehen, hält »Männervespern« über »umstrittenes Gender-Mainstreaming«. Und er hat im letzten Jahr bedauert, dass sich die evangelische Kirche »zum Schrittmacher der Kritik an der Ehe macht«. Der Realschullehrer Gabriel Stängle hat eine Protestwelle gegen den baden-württembergischen Bildungsplan ausgelöst. Hartmut Steeb, der Generalsekretär der Evangelischen Allianz, des deutschen Dachverbandes der Evangelikalen, sprang ihm schnell bei.
Das evangelikale Referenzbuch zum Thema stammt von der Katholikin Birgit Kelle. Sein Titel heißt »GenderGaga«. Es listet Kuriositäten auf, die sich Behörden, Universitäten und Gleichstellungsbüros haben einfallen lassen. Birgit Kelle ist eine Wutbürgerin. »Es ist Zeit, dass das Volk widerspricht«, endet ihr Buch. Aber das Volk widerspricht nicht. Dafür hat Kelle beim evangelikalen Informationsdienst »idea« ein Streitgespräch mit Claudia Janssen geführt. Und gesagt, dass die Bibel eindeutig ist. »In meiner Bibel steht: Als Mann und Frau schuf er sie; aber meine Bibel ist auch nicht in gendergerechter Sprache.« Genau. Claudia Janssen hat die »Bibel in gerechter Sprache« mit übersetzt, in der Gott manchmal »sie« heißt und der Heilige Geist als die Geistkraft erscheint, denn ein hebräischer Begriff für den Geist ist weiblich. In der »Bibel in gerechter Sprache« heißt es, Gott habe die Menschen »männlich und weiblich« geschaffen, aber nicht, mit welchen Anteilen davon er die Einzelnen ausgestattet hat. Die Genderdebatte ist auch ein Streit, wie die Bibel zu verstehen ist. Sie berührt fromme Menschen im Innersten und lässt sie sprachlich zum Äußersten greifen.
Doch die Fronten weichen auf. Mit Achtung in der Stimme spricht Janssen von Michael Diener. Der ist Vorsitzender der Evangelischen Allianz und damit Vorgesetzer von Hartmut Steeb. Diener hält hoch, was unter Evangelikalen mehrheitsfähig ist: dass die Bibel keine einzige freundliche Aussage zur Homosexualität macht. Aber er kämpft dafür, dass das Gespräch offen bleibt: »Wir haben ernst zu nehmen, dass auch andere Positionen in Anspruch nehmen, aus einem ehrlichen und gehorsamen Studium und Verständnis der Heiligen Schrift zu erwachsen.«
Diener weiß, dass die Evangelikalen noch jede moralische Schlacht verloren haben. Vergeblich haben sie früher gegen Nylonstrümpfe gekämpft, gegen das Tanzen und gegen Sex vor der Ehe. Das kann daran liegen, dass sie die Bibel vor allem als Gesetz verstehen - und dass sie vor allem konservativ sind, jedenfalls die Älteren. Damit haben sie sich in den letzten Jahren Feinde gemacht. »Wer Gender-Mainstreaming eine faschistische Ideologie nennt, den kann man nur daran erinnern, dass während des >Dritten Reichs< auch auf den Dächern fundamentalistisch-evangelikaler Missionswerke ganz ungestört die Hakenkreuzfahne flatterte«, hieß es im Leserbrief eines Nachrichtenmagazins. Auch Claudia Janssen macht sich Sorgen über die Nähe evangelikaler Genderkritiker zum rechten Rand der Gesellschaft. Sie hielt Birgit Kelle vor, dass die für die Zeitung »Junge Freiheit« schreibt. »Die Argumente, die Sie gegen Gender verwenden, finden sich auch in Programmen von Parteien am politisch rechten Rand«, sagte sie zu Kelle. Wechselseitig halten sich Protagonistinnen einen Hang zur Diktatur vor.
Kritikerinnen kommen auch aus der Frauenbewegung, die es mehr mit dem Feminismus und mit klaren Rollen halten. Sie versammeln sich auf dem Stuttgarter Kirchentag eher in der »interreligiösen theologischen Basisfakultät der Frauen« im alten Güterbahnhof. Doch Janssen ist auch dafür mitverantwortlich. Früher hieß sie »Feministisch-theologische Basisfakultät«. Eine zentrale Zeitschrift dieser Richtung, die »Schlangenbrut«, hat im letzten Jahr ihr Erscheinen eingestellt. An ihre Stelle trat der interreligiöse Titel »Inta« mit einem jüdisch-islamisch-christlichen Redakteurinnenkreis. Ihr neues Thema ist nicht die Vielfalt der Geschlechter, sondern der Möglichkeiten, Gott zu verehren. Manche Feministinnen sehen in der Gender-Debatte eine Mode.
Matthias weiß nichts davon. Er ist auf der Suche nach seinem Leben. Und nach Menschen, die ihn unterstützen. Er wird wenig Männer finden, die mit ihm dafür kämpfen, dass Männer akzeptiert werden, gleich wie ihr Chromosomensatz aussieht und ihr Körperbau.
Christ und Welt, Ausgabe 23/2015